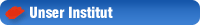Antwort von Jürgen Seewald
zum Leserbrief von Michael Passolt
Die Antwort von Miachael Passolt können Sie hier nachlesen.
Lieber Michael Passolt,
ich habe Deinen Leserbrief auf meinen Beitrag „Wann ist ein Ansatz ein Ansatz?“ mit Interesse gelesen und immer darauf gewartet, dass er in der „Praxis der Psychomotorik“ veröffentlicht wird. Das ist nun nicht geschehen, was ich einerseits verständlich und andererseits bedauerlich finde, weil er wichtige Themen der Psychomotorik und Motologie anspricht. Da er nun auf Deiner Homepage veröffentlicht und damit vielen „Eingeweihten“ zugänglich ist, möchte ich doch zu einigen Punkten Stellung nehmen.
Zunächst gleichsam als Vorspann die Form des Leserbriefs, die Du gewählt hast: Der Leserbrief erlaubt eine Mischung von persönlichen und fachlichen Aspekten. Der ins persönliche gehende Ton bzw. Unterton wird in Deinem Leserbrief sehr deutlich. Nun hast Du den Leserbrief mit einer Literaturliste versehen – was sicher sehr unüblich ist. Du vermischt damit zwei Formen, nämlich den Leserbrief und den wissenschaftlichen Artikel. Im wissenschaftlichen Diskurs gibt es eine Grundregel, nämlich den persönlichen vom fachlichen Aspekt zu trennen – nicht, weil man glaubt, dass die Person des Autors keine Rolle spielt, sondern weil das Thema im Mittelpunkt stehen sollte und Texte zuweilen eine Eigendynamik entwickeln, gleichsam als könnten sie sich von ihren Schöpfern befreien. Ich verweise auf diesen formalen Aspekt gleich zu Beginn, weil sich darin m. E. ein zentrales Problem unserer Kommunikation widerspiegelt. Wir bewegen uns in verschiedenen Diskurswelten. Wenn man sich am wissenschaftlichen Diskurs beteiligt, heißt das nicht, dass alles voller Tiefsinn und Wahrheit sein muss, was man schreibt. Es heißt nur, dass man sich an die wissenschaftlichen Diskursregeln halten muss. Mit scheint es bei Dir ungeklärt zu sein, ob Du Dich am wissenschaftlichen Diskurs beteiligen möchtest oder lieber nach eigenen freieren Regeln verfahren möchtest. Ich habe nicht zu kritisieren, wenn man letzteres bevorzugt, nur sollte man dann nicht klagen, wenn man im wissenschaftlichen Diskurs nicht oder nicht genug zur Kenntnis genommen wird. Dieser formale Aspekt taucht in mehreren inhaltlichen Punkten immer wieder auf.
1. Wissenschaft und Praxis
Du baust an mehreren Stellen einen Widerspruch zwischen der Praxis und der Wissenschaft auf. Letzterer unterstellst Du Überheblichkeit und Abgehobenheit (Elfenbeinturm) und Uninformiertheit (zumindest über Dein Werk). Du verkennst dabei (siehe oben), dass wir uns unter ganz verschiedenen Rahmenbedingungen um dieselbe Sache bemühen. Die Motologie ist universitär verankert, sie akzeptiert und befolgt die Rahmenbedingungen von Wissenschaft. Dazu zählt es, sich an die wissenschaftlichen Methoden zu halten, Argumentationsregeln zu respektieren, den Wissenskorpus zu gliedern und ihn unterscheidbar und damit auch kritisier- und revidierbar zu machen. Der Beitrag spiegelt den Versuch wider, die Unterscheidbarkeit zu steigern. Ich glaube, dass dadurch ein notwendiges Gegengewicht zur bunten Vielfalt in der Praxis geschaffen wird, die ich für genauso wichtig halte. Wir brauchen beides. Das eine ohne das andere wäre steril bzw. gut gemeint, aber verschwommen. Das sollte man nicht gegeneinander ausspielen. Im Übrigen sind wir nach wie vor ein Studiengang mit einem sehr hohen Praxisanteil – verglichen mit anderen Studiengängen. Allerdings sind wir gehalten, die Praxis stärker zu reflektieren als es der Praktiker tut bzw. tun muss – und dazu sind die Ansätze unverzichtbar. Ich halte das für Konsens im Fachdiskurs, zumindest wie er sich in der Wissenschaftlichen Vereinigung widerspiegelt.
Wir sind in diesem wissenschaftlichen Rahmen auch gehalten, vorsichtiger mit neuen Trends und Entwicklungen umzugehen. So hat es doch fast 10 Jahre gebraucht, bis wir Konsens im Fachdiskurs hatten, dass die Gesundheitsförderung ein unverzichtbares Thema von Psychomotorik und Motologie ist. Diesen Fachdiskurs verorte ich vor allem in der Wissenschaftlichen Vereinigung und in der Veröffentlichungslage, die sich wissenschaftlichen Kriterien fügt. Man kann also schlecht den Wert der Motologie, sich wissenschaftliche Fragen zu stellen, für unbestritten halten (vgl. S. 3) und ihr gleichzeitig vorwerfen, dass sie nach Unterscheidung sucht und diese mit wissenschaftlich anerkannten Argumentationsregeln zu begründen trachtet.
2. Moderne und Postmoderne
Es stimmt, die Postmoderne hat der Moderne den Glauben an die Wahrheit der großen Weltdeutungen genommen und damit Bescheidenheit und Respekt vor der Andersheit des Anderen gelehrt. In diesem Sinne gibt es kein Zurück mehr vor diese Aufklärung. Ich halte die sogenannte Postmoderne aber auch für sehr ambivalent, denn interessanterweise erklärt sie das Ende der großen Erzählungen – bis auf eine, nämlich ihre eigene. Und so argumentierst auch Du. Du glaubst an die Erzählung der Postmoderne – wieso eigentlich? Wenn Du Dich an die Annahmen der von Dir favorisierten Theorie hieltest, gäbe es keinen Grund, ihr zu glauben oder ihr den Vorzug gegenüber anderen Weltdeutungen einzuräumen. Dennoch geschieht dies und zwar durch die meisten Anhänger der Postmoderne. Hier scheint mir ein blinder Fleck zu liegen. Wieso wendet man auf die eigene Theorie andere Maßstäbe an als auf die überwunden geglaubten? Hat die Postmoderne die Moderne vielleicht doch nicht so ganz überwunden? Die Theorie der Postmoderne ist deshalb aus meiner Sicht eher ein Übergang, zudem einer, der massiv unter Ideologieverdacht steht – ist er doch die Haustheorie des globalisierten Turbo-Kapitalismus mit seinen neuen Abhängigkeiten und Ungerechtigkeiten. Gerade die Finanzkrise zeigt die Aktualität der alten Frage „Cui bono?“. Wir können m. E. nicht auf Analyse und Kritik verzichten. Diese verlangen aber zwingend nach einer Wertebasis und nach Unterscheidungen. Für mich lautet die Frage deshalb: Wie kann sich die Wertebasis der Moderne durch die Konfrontation mit der Postmoderne reformieren und fortschreiben. Was verändert sich und was bleibt übrig, vielleicht reifer, ironischer, bescheidener. Aber ich möchte z. B. das Instrument der Analyse und der Kritik nicht opfern, beides Kinder der Moderne. Ohne den Anspruch, hinter die Kulissen zu schauen, Wesen und Erscheinung zu unterscheiden, wären wir hilflos der Oberflächenmagie der Postmoderne ausgeliefert. Und darin sehe ich auch eine unterschiedliche Einschätzung der Ansätze begründet, die von Dir scheinbar als zu überwindende Relikte der Moderne gedeutet werden, die Du durch die Pluralität der Postmoderne ersetzen möchtest. Ich halte sie für unverzichtbar und für kostbar gerade in ihren jeweiligen Besonderheiten und Einseitigkeiten.
3. Beziehungsgestaltung versus Konzeptionen als Kern der Psychomotorik
Ich glaube auch: Was wirkt, ist letztlich die Beziehung zwischen Psychomotoriker und Klient. Aber sie findet nicht im luftleeren Raum statt. Das gesamte Arrangement ist wichtig und hier natürlich der Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Körperbezug. Wir haben eben diesen hervorragenden Zugang und er ist nicht dasselbe wie Spaziergehen oder Eisessen oder sonstige Aktivitäten mit Klienten. Deshalb rate ich auch hier dazu, die Dinge nicht gegeneinander auszuspielen. Die Ansätze legen eine bestimmte Beziehungsgestaltung nahe. Die Ansätze sind darüber hinaus unverzichtbar für die professionelle Sozialisation und die Sicherheit, mit der ich dem Klienten begegne. Ich sehe aber auch, dass die Diskussion bisher vielleicht etwas zu konzeptionslastig war, vielleicht infolge einer „Deformation professionelle“ der Wissenschaft, die Theoriefähiges bevorzugt und dass wir uns der Beziehung als „unspezifischem Wirkfaktor“ im Zusammenhang mit und jenseits der Ansätze stärker zuwenden sollten.
4. Psychomotorik und Motologie
Zum Ausklang noch einige Worte zu Deiner Einleitung. Die Problematik ist hier wirklich schwierig und nicht auf einen Nenner zu bringen. „Motologie“ ist eine Marburger „Marke“ und sie benennt eine Berufsgruppe und einen Berufsverband. Sie sichert dadurch gleichzeitig Wiedererkennbarkeit und Eigenständigkeit. Das sind hohe Werte, die nicht leichtfertig geopfert werden sollten. Gleichzeitig steht dem als Kehrseite gegenüber, dass der Begriff die Motologie auch isoliert und als ein Verbreitungshindernis angesehen werden kann. Psychomotorik ist der verbreiterte Begriff, der gleichzeitig aber viele Bedeutungsfacetten hat (in der in Kürze erscheinenden Enzyklopädie der Sonderpädagogik unterscheide ich 6 unterschiedliche Bedeutungen) und deshalb Profilprobleme verursacht. Es lassen sich noch weitere Argumente für und wider finden. Ein zentraler Punkt ist dabei, ob man in dieser Frage Verantwortung qua Amt hat (zuminderst für ca. 1000 Diplom und Master Motologen) oder ob man die Frage eher als Zuschauer anspricht. Für mich ist das ein Grund, eher behutsam und konservativ mit der Begriffsproblematik umzugehen.
Abschließend mein Eindruck Deiner Replik auf meinen Artikel: Er enthält Anregungen, über die man ins Gespräch kommen kann (z. B. Beziehung als zentraler Wirkfaktor) und er polarisiert und trennt, was eher zusammengehört. Mein Beitrag in der „Praxis der Psychomotorik“ ist sicher ein Ordnungsvorschlag, aber eben nur ein Vorschlag. Er beansprucht keine Definitionsgewalt, weil dies ohnehin zwecklos wäre. Fachdiskurse entscheiden unter vielfältigen Aspekten, welchen Gedanken sie aufnehmen und akzeptieren und welchen nicht. Diese Erfahrung habe ich schon öfter gemacht, so etwa beim Begriff „Meisterlehre“, der von vielen akzeptiert wurde oder „Paradigma“, wo sich die Anzeichen der Akzeptanz mehren. Ich betrachte diese Begriffs- und Ordnungsvorschläge als Teil meiner Aufgabe, die mir Freude macht und die ich für notwendig halte, ohne dass ich sie zum Maß aller Dinge machen möchte.
Mit kollegialen Grüßen
Jürgen Seewald